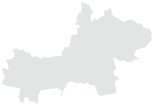Die Kommune als Schwamm

13. Juni 2024 - Hitze, Trockenheit, Stürme, Starkregen, Hochwasser, Überschwemmungen: Die Folgen des Klimawandels sind vielfältig. Auch die Kommunen im Main-Kinzig-Kreis bereiten sich auf Extremereignisse und mögliche Folgen vor. Sie beteiligen sich unter anderem seit gut einem Jahr daran, gemeinsam mit dem Kreis ein nachhaltiges Klimaanpassungskonzept (KLAK) zu erstellen. Bis Ende Juli soll es fertig sein. Im Main-Kinzig-Forum fand kürzlich ein Vortragsabend „Neue Impulse zur nachhaltigen Entwicklung von Städten und Gemeinden“ statt, der einmal mehr Möglichkeiten der Klimaanpassung auf kommunaler Ebene in den Blick nahm. Eingeladen hatte die Beate Heraeus Foundation in Kooperation mit dem Main-Kinzig-Kreis. Etwa 80 Vertreterinnen und Vertreter der Städte und Gemeinden sowie interessierte Bürgerinnen und Bürger nutzten die Gelegenheit, sich über die Stadtentwicklung der Zukunft auszutauschen.
In seiner Begrüßung betonte Landrat und Hausherr Thorsten Stolz: „Uns ist es ein wichtiges Anliegen, Bewusstsein für die Herausforderungen des Klimawandels zu schaffen. Mit der Veranstaltung möchten wir sowohl den Kommunen als auch Menschen, die in unserer Region leben, eine weitere Plattform bieten.“ Es gehe um Denkanstöße und Impulse für all jene, die sich in ihren Kommunen zumeist ehrenamtlich engagieren. „Sie sind es, die zum Beispiel zur kommunalen Bauleitplanung in den Parlamenten richtungsweisende Entscheidungen treffen.“ Der Kreis habe in den letzten Jahren bereits Projekte zum Klimaschutz und zur Klimaanpassung angepackt und umgesetzt, so etwa „Main.Kinzig.Blüht.Netz“, eine Initiative mit dem Ziel, vernetzte Lebensräume für Insekten zu schaffen und aufzuwerten. „Auch in Sachen Energieversorgung ist der Main-Kinzig-Kreis erfolgreich. Von Maintal bis Sinntal wird so viel Strom aus erneuerbaren Energien gewonnen, dass er ausreicht, um die privaten Haushalte zu versorgen“, so der Landrat. Dieser Strom stamme aus 13.000 Photovoltaik-, 39 Biomasse-, 29 Wasserkraft- und 115 Windkraftanlagen. „Wir wollen in Sachen Wasserversorgung klimaunabhängiger werden, deshalb entsteht am Kinzigstausee ein Oberflächenwasserwerk. Es wird dazu beitragen, den wachsenden Wasserbedarf zu decken.“ Der Main-Kinzig-Kreis und die 29 Kommunen seien auf einem guten Weg. Im Klimaanpassungskonzept sei zudem vieles enthalten, dass es den Kommunen erleichtere, konkrete Maßnahmen umzusetzen.
Dr. h.c. Beate Heraeus, Gründerin der gleichnamigen Stiftung, dankte dem Landrat in einem Grußwort für die gemeinsame Veranstaltung. „Wir sprechen hier nicht über etwas Banales, sondern über etwas, das unsere Existenz betrifft.“ Die Menschen sollten nicht nur Forderungen an Politik und Gesellschaft stellen, sondern an jenen Stellen, an denen sie etwas bewirken könnten, selbst aktiv werden. Jeder und jede einzelne sei gefragt mit Mut und Fantasie, das Gemeinwohl im Blick, Hindernisse anzugehen und zu überwinden, so die Stifterin und ergänzte: „Wer für eine Sache brennt, kann andere im eigenen Umfeld überzeugen.“ Die erfolgreiche Kooperation mit dem Main-Kinzig-Kreis habe sie im Übrigen zum Anlass genommen, weitere Landkreise anzusprechen, um ähnliche Veranstaltungen zu realisieren und die Bewegung größer zu machen, unterstrich Beate Heraeus.
Dr. Anna-Christine Sander vom Fachzentrum Klimawandel und Anpassung des Hessischen Landesamtes für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) widmete sich in ihrem Vortrag der Idee der Stadt als Schwamm. Dabei nehmen Areale im urbanen Raum Wasser lokal auf. Es wird gespeichert, verdunstet oder versickert. Zu den Bausteinen der Schwammstadt gehören zum Beispiel Dach- und Fassadenbegrünung, Bäume, entsiegelte oder Regenwasserrückhalteflächen und renaturierte Gewässer. Den Teilnehmenden stellte sie zudem Angebote der HLNUG vor, die Kommunen auf dem Weg zur Klimaanpassung als Handlungshilfen dienen können.
Nach der Pause vertiefte Dr.-Ing. Simon Gehrmann, Fachgebiet Entwerfen und Stadtentwicklung am Fachbereich Architektur der Technischen Universität Darmstadt, in seinem Vortrag „Wassersensitive Gestaltung von Kommunen“ das Thema. Ein zukunftsfähiges Konzept für Kommunen, so der Wissenschaftler, müsse bei der wassersensitiven Gestaltung auch soziale, kulturelle, ökologische und ökonomische Faktoren berücksichtigen. Er präsentierte drei wassersensible Projekte im Detail: In Adelaide wird der Landwirtschaft gereinigtes Wasser der Kläranlagen zur Verfügung gestellt. In Melbourne wird ein Park mit lokal gesammeltem, gefiltertem und gespeichertem Regenwasser bewässert. In Mannheim wird die Aubuckel Siedlung wassersensitiv umgestaltet. Dazu wird Grauwasser gesammelt und gereinigt. Außerdem ist ein Retentionsraum, sprich eine Teichanlage, geplant, die sogar auf hundertjährigen Regen ausgelegt ist. Professor Jan Dieterle, Landschaftsarchitekt und Professor „Nachhaltige Freiraum und Stadtgestaltung“ an der Frankfurter University of Applied Sciences, wandte sich in seinem Vortrag „Regenerative Kommunen“ grüner und blauer Infrastruktur zu, die Vegetation und Wasser Raum lässt und beides sowohl stadtplanerisch als auch strategisch vernetzt. Grundsätzlich müssten Kommunen die Frage beantworten, wie Zusammenleben aller und Gemeinwohl künftig gestaltet werden sollen, so der Landschaftsarchitekt.
Weitere Informationen zum Vortragsabend finden sich auf der Kreisseite www.mkk.de unter „ Aktuelles/Themen/Klimaschutz “.
Lebenslagen
- Wirtschaft
- Arbeit und Soziales
- Auto, Verkehr und ÖPNV
- Bauen und Wohnen
- Bildung, Schule und Medien
- Frauenfragen und Chancengleichheit
- Kultur, Sport und Ehrenamt
- Gesundheit
- Familie, Kinder und Jugendliche
- Zuwanderung und Integration
- Natur, Umwelt, Landwirtschaft und Tierschutz
- Sicherheit und Ordnung
- Behinderung, Pflege und Alter
Hausanschrift
Main-Kinzig-Forum
Barbarossastraße 16-24
63571 Gelnhausen
Telefon: 06051 85-0
Telefax: 06051 85-77
E-Mail: buergerportal@mkk.de